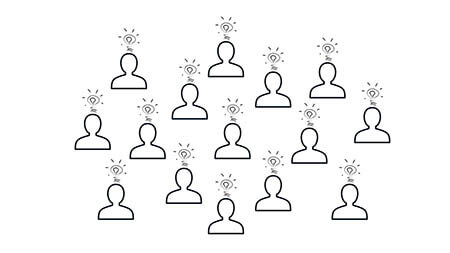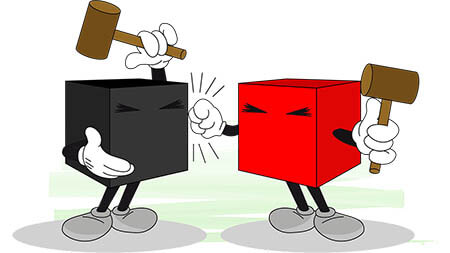Auswege aus Selbsthass und Autoaggression

![]() 1989 fand eine internationale Konferenz für Buddhismus im Beisein des Dalai Lamas statt. Einer der westlichen Lehrer, Jack Kornfield, sprach die Themen Selbsthass, Scham und Gefühle der Wertlosigkeit an. Der Dalai Lama verstand den Begriff Selbsthass nicht. Zehn Minuten lang versuchte der Übersetzer zu erklären, was gemeint war. Als der Dalai Lama den Begriff erfasst hatte, rief er erschüttert
1989 fand eine internationale Konferenz für Buddhismus im Beisein des Dalai Lamas statt. Einer der westlichen Lehrer, Jack Kornfield, sprach die Themen Selbsthass, Scham und Gefühle der Wertlosigkeit an. Der Dalai Lama verstand den Begriff Selbsthass nicht. Zehn Minuten lang versuchte der Übersetzer zu erklären, was gemeint war. Als der Dalai Lama den Begriff erfasst hatte, rief er erschüttert
„Aber das ist ein Irrtum!“
Vorher hatte der Dalai gefragt, wer im Auditorium betroffen sei. Fast alle hatten genickt oder die Hand gehoben. Selbsthass und Selbstablehnung sind in der westlichen Kultur weit verbreitet. Auch wenn es keine direkte Diagnose dafür gibt, beschreibt die Psychologie die Rolle von Selbstablehnung in der Entstehung von seelischen Krankheiten sehr klar. Bereits in den 70er Jahren hat man dysfunktionales Denken – negatives Denken über sich selbst – als bedeutende Ursache für die Entstehung von Depressionen erkannt. Bei Borderline-Störungen spielt selbstverletzendes Verhalten („Ritzen“ oder „Burnen“) eine große Rolle. Das Grundgefühl „nichts wirklich zu bieten zu haben“ ist eine der Ursachen für eine selbstunsichere Persönlichkeitsstörung. Bei der Magersucht ist die Angst, „irgendwie unförmig oder nicht richtig zu sein“ am Krankheitsgeschehen zentral beteiligt.
Wenn toxische Scham jeden Tag vergiftet
Schamgefühle können sehr unangenehm sein, doch verfolgen sie einen sinnvolles Ziel: sie halten uns vor unangemessenen Handlungen zurück, z.B. eine Gewalttat zu begehen oder uns vor Fremden zu freizügig zu geben. Sie hindern uns daran, Dinge zu tun, mit denen wir andere oder uns selbst verletzen und die wir später bereuen würden.
Im Gegensatz zu dieser gesunden und natürlichen Scham vergiftet toxische Scham uns permanent selbst. Fast alle Menschen kennen negative Gedanken wie „immer passiert das mir“, „ich bin nicht gut (genug)“, „irgendetwas stimmt nicht mit mir“ usw. Wenn solche Gedanken punktuell auftreten und man sich davon wieder distanzieren kann, ist alles im grünen Bereich. Aber aus meiner Praxis weiß ich, dass viele Menschen von morgens bis abends gefangen sind in einem Gedankenstrom aus negativen Selbstzuschreibungen. Ständig finden sie einen Grund, sich selbst zu kritisieren und abzuwerten. Doch fragt man nach, stellt sich heraus, dass sie fürsorgliche Eltern sind und Herausforderungen auf der Arbeit und im Alltag meistens gut bewältigen.
Trotz dieser Erfolge bleibt das Denken und Fühlen oftmals in einer überkritischen Sicht auf sich selbst verhaftet. Alles, was diese Menschen machen und erleben, ist durchtränkt von Gefühlen der Unzulänglichkeit und Minderwertigkeit. Ständig ist das Glas halbleer und irgendwie sowieso falsch. Noch Jahre später grübeln Betroffene darüber nach, wie sie sich in längst vergangenen Situation hätten besser verhalten können und machen sich Vorwürfe deswegen.
Häufig findet man auch das Muster, sich selbst alles schlecht zu machen. Wie oft habe ich gehört, dass jemand auf ein neues Auto oder E-Bike gespart hat und als er oder sie es gekauft hatte, fürchterliche Gewissensbisse und Selbstvorwürfe hatte. Es fällt solchen Menschen schwer bis unmöglich, die Schönheit des Lebens anzunehmen. Selbst wenn sie Gutes erleben, haben sie hinterher das Gefühl, dass es schon wieder vorbei ist und nicht wiederkommt. Wenn sie selbst etwa gut machen, kritisieren sie, dass sie es nicht besser gemacht haben.
Auswirkungen toxischer Scham
Mich stimmt es traurig zu sehen, wenn Menschen sich selbst boykottieren. Als Homo Sapiens, als wissende Menschen, sind wir geistig unbegrenzte Wesen, die weit über sich selbst hinaus wachsen können. Toxische Scham blockiert unser Potenzial, weil sie uns pausenlos deprimiert. Sie versetzt uns in einen Dauerstress, der uns unfrei macht und Zufriedenheit und Glück weit weg rücken lässt. Der innere Stress entsteht durch das Grundgefühl, dass etwas nicht stimmt und dass wir etwas ändern müssen. So strengen wir uns dauernd an, ohne jedoch unser Ziel zu erreichen. Die Selbstablehnung sorgt dafür, dass wir alles Erreichte wieder schlecht machen, so unter dem Motto „es war nicht wirklich gut“. Erfolge genießen geht nicht, uns belohnen schon gar nicht. Ständig bleiben wir im Hamsterrad übersteigerter Selbstansprüche gefangen.
Psychosomatisch findet toxische Scham oft einen Ausdruck finden in übergroßer Anspannung, Verdauungsbeschwerden, Konzentrations- und Schlafstörungen. Besonders das nächtliche Knirschen mit den Zähnen und psychosomatischen Schmerzen ohne organische Ursachen machen den autoaggressiven Charakter der toxischen Scham deutlich.
Manchmal verbirgt sich hinter dem Phänomen toxische Scham folgendes Glaubensmuster: „Wenn ich lange genug leide, wird es mir eines Tages gut gehen“. Als könnte man Glück und Zufriedenheit mit Leiden erkaufen! Das wird nicht funktionieren. Wohlfühlen und Entspannung entstehen durch Ruhe und inneres Loslassen. Zielführender ist es zu fragen, warum kann die betreffende Person nicht entspannen? Was ist in ihrer Biografie passiert, wie ist ihre Psyche geprägt, so dass Dysstress und Selbstablehnung das Erleben erzeugen und prägen.
Es wird deutlich, dass das gesamte Erleben der Betroffenen durch die tief verwurzelten Selbstzweifel und das Grundgefühl, wertlos bzw. minderwertig zu sein, verzerrt ist. Diese Verzerrung erstreckt sich natürlich auch auf andere Menschen. Wer mit sich selbst im Unreinen ist, hat Schwierigkeiten, anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Andere werden nicht als Bereicherung erlebt, sondern eher als fordernd oder anstrengend. Gerne werden die eigenen Gefühle der Minderwertigkeit auf sie projiziert und diese Menschen damit innerlich abgewertet. Gute Beziehungen sind Menschen, die unter toxischer Scham leiden, meistens unbekannt. Häufig geraten sie an Narzisten oder sadistische Partner, die sie fortlaufend demütigen und verletzen.
Anstatt die eigene Lebendigkeit und Kreativität frei fließen zu lassen und zu genießen, deprimieren sich Menschen mit toxischer Scham ständig selbst, als würden sie unter einem Wiederholungszwang stehen. Die Folgen sind Lustlosigkeit, Rückzug und Isolation Selbstzweifel statt Selbstvertrauen, wachsende Angst – ein Teufelskreislauf, dem nur mühselig zu entkommen ist.
Zur Entstehung der toxischen Scham
Menschen mit toxischer Scham werden von negativen Gedanken und Gefühlen überschwemmt. Doch brauchen sie eine Weile, bis sie verstehen, dass sie psychisch verletzt sind und dass die toxische Scham in sie hineingetan wurde. In der Regel sind Betroffene mehrfach traumatisiert, oft ohne dass sie es wissen. Nicht selten behaupten sie, eine schöne Kindheit gehabt zu haben, doch fragt man nach, offenbaren sich die erlittenen Traumata.
Häufig beginnt es mit dem Trauma des Ungewollt-Seins: Die Eltern wollten eine Familie und brauchten ein oder mehrere Kinder dazu. Aber geht es hier um die Kinder oder um das Bild einer heilen Familie? Sind die Kinder mit ihrem ureigenen Wesen erwünscht oder sind sie nur Platzhalter, die nett lächeln sollen?
Ein verbreiteter Aspekt in unserer Kultur ist, dass Kinder normalerweise nicht die Liebe und Anerkennung bekommen, die sie brauchen. Liebe bzw. der Entzug von Liebe wird als Erziehungsmittel missbraucht: „Räum' erst dein Zimmer auf, streng' dich an in der Schule, sei nett zu Oma und Opa, dann bekommst du vielleicht die Zuwendung, die du dir so ersehnst.“ In der Psychologie wird dieser Umstand als Trauma der Liebe beschrieben.
Die so entstehenden Gefühle des Ungewollt- und Ungeliebt-Seins erschweren die Entwicklung eines gesunden Ichs. Der Aufbau eines stabilen Selbstwertgefühls ist kaum möglich. Die innere Stimme kann oft nicht wahrgenommen werden oder sie wird überhört, weil der Hunger nach Liebe und Anerkennung so übergroß ist. So werden Kinder anfällig für Missbrauch. Damit ist nicht gleich sexueller Missbrauch gemeint. Oft genug werden Kinder psychisch missbraucht, in dem sie von einem Elternteil als seelischer Ersatzpartner herangezogen werden oder mit Themen konfrontiert werden, die Kinder nichts angehen. Manchmal sollen sie im Familiensystem etwas ausgleichen, was nicht ihre Aufgabe ist oder sie sollen etwas erfüllen, was die Eltern nicht geschafft haben. In jedem Fall bleiben sie schutzlos, was sie dafür anfällig macht, sich von anderen Menschen ausnutzen zu lassen.
Noch immer erleben Kinder Gewalt, psychischer, körperlicher oder sexueller Natur. Diese grausamen Erfahrungen sind tief verletzend. Die Tatsache, dass diese Verbrechen von Menschen verübt werden, denen man existenziell ausgeliefert ist, macht sie nicht selten unauslöschlich. Kinder können sich in der Regel nicht dagegen wehren und verinnerlichen die Täter in ihrer Psyche. Die Folge ist, dass diese innerpsychischen Täteranteile später immer wieder aggressiv werden und Betroffenen sich dann selbst beschimpfen oder Sätze denken wie „ich habe es auch nicht besser verdient“.
Eine solche oder ähnliche Biografie hinterlässt ihre Spuren. Schon oben wurde erwähnt, dass es so schwer bis unmöglich ist, eine klare Identität herauszubilden. Die Betroffenen erleben sich als emotional instabil und/ oder als innerlich zerrissen, mal überdreht und sehr präsent, dann wieder taub und wie gar nicht wirklich da. Die damit verbundenen problematischen Gefühle sind neuronal gebahnt und werden im erwachsenen Leben immer wieder aktiviert, wogegen auch kein krampfhaftes positives Denken hilft.
Das Gefühl gut und richtig zu sein, es gut mit sich selbst auszuhalten, ist ihnen fremd, weil sie es nicht erfahren haben. Das Gefühl, versagt zu haben, hat sich in ihnen tief verwurzelt, weil die Erfahrung, eine Freude der Eltern zu sein, gefehlt hat. Stattdessen machen sie sich selbst dafür verantwortlich, dass ihnen Liebe und Schutz versagt worden ist.
In der Abhängigkeit von den Eltern können wir deren Verhalten nicht abschätzen und sagen eher „irgendetwas scheint mit mir nicht zu stimmen, sonst würde es mir ja besser gehen.“ Um unsere Lage einigermaßen erträglich zu machen, beginnen wir, unserer wahres Sein und unsere wahren Bedürfnisse zu verleugnen und fangen an, uns zu unterwerfen.
Dann ist alles angelegt, was im erwachsenen Leben hinderlich ist: ständig die Schuld bei uns selbst suchen und sich selbst damit Druck machen, in quälenden Situationen verharren, statt auszubrechen, sich über Gebühr anstrengen, sich mit Menschen einlassen, die einem nicht gut tun, die eigene innere Stimme nicht hören, sich nicht belohnen oder ausruhen können usw.
Wege aus Selbsthass und Autoaggression
Auch eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt, lautet ein chinesisches Sprichwort. Der erste Schritt raus aus der toxischen Scham ist, sie anzuerkennen. Sicher ist es nicht nice sich selbst einzugestehen, dass man gar kein freundliches Verhältnis zu sich selbst hat, dass man sich den ganzen Tag runtermacht, sich vielleicht sogar selbst hasst. Doch erst wenn man zugibt, dass etwas nicht okay ist, kann man anfangen es zu ändern.
Am Anfang darf auch das Gefühl der Aussichtslosigkeit stehen. Doch macht es einen großen Unterschied, ob man sagt „ich komme da nicht raus“ oder „ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme, aber ich werde jeden Stein umdrehen, um es herauszufinden“. Bei Aussage 1 bleibt die Tür verschlossen, bei Aussage 2 öffnet sie sich ein Spalt breit.
Es ist deutlich geworden, wie massiv toxische Scham die Betroffenen in Form von negativen Gedanken überschwemmt. Deshalb ist es wichtig, diese aggressiven Stimmen im Kopf zurückzudrängen. Das geht, in dem man ihnen widerspricht und ihnen befiehlt zu schweigen. Diese Veränderungen brauchen Zeit und man sollte üben, sich für jeden kleinen Fortschritt zu belohnen. Sehr hilfreich ist hier die Technik des Gedankenstopps. Sie stammt aus der Verhaltenstherapie und hat vielen Menschen geholfen, ihre negativen Gedanken in den Griff zu bekommen und somit innere Freiheit zu schaffen für neues Erleben. Die Technik des Gedankenstopps hier zu beschreiben würde zu weit führen, aber sie kann bequem im Internet nachgelesen werden.
Über die Jahre ist toxische Scham auch zu einer Gewohnheit geworden. Es führt kein Weg daran vorbei, mit sich selbst ehrlich zu sein und zu beobachten, wo man wieder in abwertende Muster verfällt. Wenn das der Fall ist, gilt es einen Realitätscheck zu machen: Ist es in Wirklichkeit schlecht oder sehe ich die Welt jetzt wieder automatisch schlecht? Dieses Verfahren schafft auf Dauer Ich-Stärke und ein gesundes Ich kann entscheiden, was es will und was nicht.
Zur Arbeit an gewohnheitsmäßigen Gedanken- und Gefühlsmustern gehört das Aufspüren von negativen Glaubenssätzen. Diese wenig rationalen Sätze haben destruktive Auswirkungen auf das ganze Leben. Oft sind sie schwer zu greifen, weil sie eher diffus gefühlt als klar gedacht werden. Strebt man im Beruf nach Perfektion und verhält sich in Beziehungen kompliziert, könnte ein Glaubenssatz wie „ich genüge nicht“ dahinter stecken. Hat man ihn aufgedeckt, wird er umgewandelt; aus „ich genüge nicht“ wird „ich mache es so gut ich kann“ oder „so wie ich es mache, ist es gut genug“. Am besten notiert man die neuen Sätze gut sichtbar und sagt sie sich selbst mehrfach am Tag.
Die allgemein negative Sichtweise, die der toxische Scham eigen ist, durchbricht man am besten, in dem man sich abends vergegenwärtigt, was am Tag gut war. Aufschreiben kann nicht schaden! Viele Menschen haben eher ein pessimistische Erwartungen und sind erleichtert, wenn nichts Schlimmes passiert ist. Lustvoller wird der Tag, wenn man seine Aufmerksamkeit auf unerwartete positive Überraschungen lenkt. So gelingt es mehr und mehr, sich darüber zu freuen.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist, seine Beziehungen zu ordnen. Nicht jeder Mensch tut uns gut, auch wenn er es vorgibt. Hier zählt allein die innere Stimme, die sehr genau spürt, ob Menschen uns gut tun oder ob sie uns in alte Verhaltensmuster drängen, die wir ablegen wollen. Hier muss man einen Weg finden, den Kontakt umzugestalten. Ein Klärungsgespräch kann helfen, notfalls muss die Beziehung eine Weile pausieren. – Und warum nicht mehr Kontakt suchen zu Menschen, in deren Gegenwart man sich wohlfühlt, die witzig und warmherzig sind? Meistens freuen sich diese Menschen über jede neue Begegnung.
Ein Herausforderung ist, neues Verhalten auszuprobieren, z.B. sich nicht mehr von Kollegen vollquatschen zu lassen, sondern aufzustehen und zu sagen „ich hol' mir jetzt einen Kaffee, soll ich dir einen mitbringen?“, um sie dann zu bitten, weniger zu reden, damit man sich auf die Arbeit konzentrieren kann. Eine schöne Übung ist auch, vertrauten Menschen zu sagen, was man an ihnen mag oder sie zu fragen, was sie an einem schätzen. Die meisten sind überrascht, was sie dann Positives zu hören bekommen.
Der Weg raus aus der toxischen Scham verlangt viel Geduld und Durchhaltevermögen. Hilfreich kann es sein, eine zeitlang die Begleitung eines Therapeuten oder einer Therapeutin in Anspruch zu nehmen. Professionelle Unterstützung kann notwendig sein, wenn die Schamgefühle sehr verdichtet sind. In jedem Fall beschleunigt die Unterstützung die Entwicklung raus aus den alten Mustern.
Der lange Weg zu unserem wahren Selbst ist nicht leicht. Mit Hindernissen und Rückfällen ist zu rechnen, aber auch mit Erfolgen, mit ungeahnten Möglichkeiten, mit emotionalem Reichtum und erfüllenden glücklichen Beziehungen und dem befriedigenden Gefühl, ich selbst zu sein und mein Leben leben zu können.
Autor: Peter Klapprot, Heilpraktiker (Psychotherapie)
Thema: Irrtum toxische Scham
Webseite: https://www.psychotherapie-ruhr.de
#Stress, #Angst, #Depressionen, #Motivation, #Verhaltensmuster, #Einsamkeit, #Gedanken, #Unterbewusstsein, #Probleme, #Selbstbewusstsein, #Trauma, #Gefühle, #Zufriedenheit, #Gesellschaftssystem