Es gibt unterschiedliche Perspektiven auf die Frage, was ein Trauma ist. Grundsätzlich wird der Begriff Trauma (griech: Wunde, Verletzung) in der Psychologie nicht einheitlich verwendet. Er kann sowohl das auslösende Ereignis bezeichnen, als auch Symptome oder hervorgerufenes inneres Leiden.

Der Begriff Trauma
Als Begriff im Zusammenhang mit einem besonders einschneidenden Erlebnis wurde Trauma erstmals durch Hermann Oppenheim (1857-1919) eingeführt, einen deutschsprachigen Arzt, der psychische Folgen lebensbedrohlicher Eisenbahn- und Arbeitsunfälle untersuchte. Bis dahin wurde von Trauma nur im Zusammenhang mit abrupten körperlichen Verletzungen in der medizinischen Unfallheilkunde gesprochen (vgl. Maercker, 2017).
Freud formuliert in seinen Forschungen die „… Entwicklung der Reihe Angst – Gefahr – Hilflosigkeit“, wenn es um eine traumatische Erfahrung geht. In der Beziehung zur traumatischen Situation treffen äußere und innere Gefahr, Realgefahr und Triebanspruch zusammen. Aufgrund der Hilflosigkeit können wir unseren inneren Bedürfnissen in der Gefahrensituation nicht nachgehen und leiden in der Folge an diesen nicht erfüllten Bedürfnissen (vgl. Freud, 2017).
In der medizinischen wie psychologischen Fachliteratur bezeichnet Trauma ein Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde.
Fischer und Riedesser (2003) definieren den Begriff Trauma als: „[…] ein vitales Diskrepanz Erlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.“
Meinungen und Aussagen zum Thema Trauma
Die politischen wie therapeutischen Aussagen zum Thema Trauma reichen von der Meinung, dieser Begriff werde mittlerweile inflationär verwendet bis hin zur Ansicht, in der deutschen Kriegs- und Nachkriegsgeneration gäbe es nahezu niemanden, der nicht traumatisiert worden wäre durch das Kriegsgeschehen selbst, das Chaos im Wiederaufbau oder den zwar unsichtbaren, aber doch psychisch massiv lastenden Druck, dem „deutschen Tätervolk“ anzugehören.
Die DSM (=Diagnostical and Statistical Manual for Mental Disorders) III-R (1987) bezeichnet Trauma als Ereignis, das außerhalb der normalen menschlichen Erfahrung liegt und die DSM IV (1994) führt aus, dass traumatische Erfahrungen solche sind, in denen eine Konfrontation mit Tod, Lebensgefahr oder starker Körperverletzung geschieht. Es kann dabei sowohl traumatisierend sein, selbst verletzt zu werden wie auch mitzuerleben, dass andere lebensgefährlich verletzt oder getötet werden. Begleitet wird ein solches Erlebnis von intensiver Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen (vgl. Bernardy, Friedmann, 2015).
Ereignisse, die zu einem Trauma führen können
- Unfälle mit ernsthaften Verletzungen
- lebensbedrohliche Krankheiten
- Natur- oder durch andere Menschen verursachte Katastrophen
- Kriege und Kampfeinsätze
- Kriegsgefangenschaft
- Terroranschlag
- Entführung
- Geiselnahme
- politische Haft
- Folterung
- Vertreibung
- Terroranschläge
- sexuelle oder sexualisierte Gewalt
- Beobachtung des gewaltsamen Todes anderer
- Verlust der Eltern in der Kindheit
- ausgeprägte emotionale oder körperliche Vernachlässigung in der Kindheit, etc.
Individuelle Disposition
Eine weitere Rolle spielt aus psychotherapeutischer Sicht die individuelle Disposition eines Menschen. Je nach innerem Erleben können so auch weniger dramatisch erscheinende Ereignisse dazu führen, dass ein Mensch in intensive Hilflosigkeit gerät und keine eigenen Bewältigungsmöglichkeiten mehr hat.
Hierzu zählen beispielsweise schwere persönliche Angriffe, das Gefühl, blamiert oder verschmäht zu sein, länger andauernde Manipulation, Mobbing, emotionaler Missbrauch, körperliche Misshandlung, Trennung bzw. Verlust des Partners oder des Kontaktes zu den eigenen Kindern, traumatisierendes Geburtserleben, etc.
Auch Menschen (z.B. Helfer, Einsatzkräfte), die mit Trauma-Folgen anderer konfrontiert werden, können dadurch selbst traumatisiert werden. Ein Arzt ist es beispielsweise berufsbedingt gewohnt, mit schweren Verletzungen anderer umzugehen, ohne in einen Zustand von schutzloser Hilflosigkeit zu geraten. Ein Laie kann von derselben Situation traumatisiert werden. Ob und in welchem Umfang eine Situation tatsächlich traumatische Symptome hinterlässt und welches Krankheitsbild möglicherweise entsteht, hängt aus therapeutischer Sicht also nicht nur von den äußeren Umständen ab. Wesentlich sind auch das innere Erleben, die persönlichen Bewältigungsmöglichkeiten, die Unterstützung des sozialen Umfelds und viele weitere Faktoren.
Diagnose eines Traumas und Traumafolgestörungen

In der ICD 10 – der internationalen Klassifikation von psychischen Störungen – werden der Zeitfaktor und das Vorliegen traumatischer Symptome für die Stellung einer entsprechenden Diagnose differenziert betrachtet.
F43.0 Akute Belastungsreaktion
Sie bezeichnet eine vorübergehende Störung, die sich bei einem psychisch nicht manifest gestörten Menschen als Reaktion auf eine außergewöhnliche physische oder psychische Belastung entwickelt und die im Allgemeinen innerhalb von Stunden oder Tagen abklingt. Sie zeigt typischerweise ein gemischtes und wechselndes Bild, beginnend mit einer Art von Betäubung, mit einer gewissen Bewusstseinseinengung und eingeschränkten Aufmerksamkeit. Des Weiteren die Unfähigkeit, Reize zu verarbeiten, Desorientiertheit, Rückzug aus der Umweltsituation, Unruhezustand und Überaktivität oder vegetative Zeichen panischer Angst (z.B. Tachykardie, Schwitzen, Erröten), etc.
F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Eine Posttraumatische Belastungsstörung ist die mögliche Folgereaktion auf eines oder mehrere traumatischer Ereignisse (selbst erlebte oder an fremden Personen erlebte). Sie entsteht als verzögerte Reaktion.
Diagnostische Kriterien eines Traumas
Kriterium A: Die betreffende Person war einem kurz- oder langanhaltenden Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß ausgesetzt, das bei nahezu jedem eine tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde.
Kriterium B: Anhaltende Erinnerungen oder Wiedererleben der Belastung durch aufdringliche Nachhallerinnerungen (Flashbacks), lebendige Erinnerungen / Gedanken (Intrusionen), sich wiederholende Träume oder durch innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen.
Kriterium C: Umstände, die der Belastung ähneln oder mit ihr im Zusammenhang stehen, werden tatsächlich oder möglichst vermieden (=Vermeidung traumaassoziierter Stimuli). Dieses Verhalten bestand nicht vor dem belastenden Erlebnis.
Kriterium D: Entweder 1. oder 2.
Teilweise oder vollständige Unfähigkeit, einige wichtige Aspekte der Belastung zu erinnern (Erinnerungslücken, partielle Amnesie).Anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung (nicht vorhanden vor der Belastung) mit zwei oder mehr der folgenden Merkmale:
- Ein- und Durchschlafstörungen
- Reizbarkeit oder Wutausbrüche
- Konzentrationsschwierigkeiten
- Hypervigilanz (erhöhte Wachsamkeit / Alarmbereitschaft)
- erhöhte Schreckhaftigkeit
Ebenso mögliche Reaktionen sind emotionale Taubheit, allgemeiner Rückzug, Interesseverlust, innere Teilnahmslosigkeit, Suizidalität.
Kriterium E: Die Kriterien B., C., und D. treten innerhalb von sechs Monaten nach dem Belastungsereignis oder nach Ende einer Belastungsperiode auf. Aus bestimmten Gründen, z.B. wissenschaftliche Untersuchungen, kann ein späterer Beginn berücksichtigt werden, dies sollte aber gesondert angegeben werden. (vgl. ICD 10, 2014).
Kriterium F: Leiden bzw. Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen und anderen Funktionsbereichen.
Sind die Kriterien A bis E erfüllt, spricht man vom Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das Überschreiten der Schwelle zu diesem Vollbild kann sowohl durch ein einziges traumatisches Ereignis geschehen, als auch Folge von kumulativen Erfahrungen sein, die erst in ihre Summe eine traumatische Belastung darstellen (vgl. Dilling, Freyberger, 2014).
Im Kindesalter finden sich teilweise veränderte Symptomausprägungen:
- wiederholtes Durchspielen des traumatischen Erlebens
- Verhaltensauffälligkeiten, z.B. aggressive Verhaltensmuster
- Rückzug
- Kaum noch Blickkontakt aufnehmen / starrer Blick
- Nicht auf Ansprechen reagieren
- Körperliche Schmerzen (Bauch, Ohren, Kopf, etc.)
- Nachspielen von als traumatisch erlebten Erlebnisinhalten
- Übermäßiges Weinen in Situationen, die vorher besser verkraftet wurden
Die Symptomatik kann unmittelbar oder auch mit (z.T. mehrjähriger) Verzögerung nach dem traumatischen Geschehen auftreten (late-onset PTSD).
Was ist ein Flashback?
Flashbacks unterliegen den Grundprinzipien des Erinnerns und Lernens. Sie werden durch Schlüsselreize hervorgerufen und sind zunächst ein völlig natürliches Phänomen in unserem Leben. Etwa wenn uns ein Duft an unsere Kindheit erinnert oder wenn uns Musik oder Bilder in alten Erinnerungen schwelgen lassen. Unser Gehirn arbeitet assoziativ und unterscheidet nicht, ob wir willentlich einen Flashback haben wollen oder nicht. Düfte, Musik oder Bilder können uns also auch an äußerst unangenehme oder traumatische Erfahrungen erinnern.
In der Psychologie meint Flashback unwillkürlich auftauchende Erinnerungen, die so stark sind, dass wir die aufgescheuchte Erfahrung wieder durchleben, unfähig, sie völlig als Erinnerung zu erkennen. In der Psychotraumatologie verwendet man analog den Begriff Intrusion. Sie können in Form von Erinnerungsblitzen auftreten wie beispielsweise Bildern, die einem auf einmal ganz deutlich vor Augen stehen. Sie können wie ein Film vor dem inneren Auge ablaufen oder ohne Bilder als emotionale Erinnerungen im Körper, psychosomatische Reaktion oder als Stimmung spürbar sein. Sehr oft werden Bilder und Emotionen abgespalten voneinander in unterschiedlichen Flashs erlebt.
Eine weitere typische Form von Flashbacks ist das Wiedererleben von Gerüchen, die mit dem traumatischen Erlebnis in Verbindung stehen: „Jedes Mal, wenn ich an der Unfallstelle vorbeifahre, habe ich wieder den Geruch des verbrannten Wagens in der Nase, der sich um den Baum gewickelt hat.“ (Ein Polizist). Auch körperliche Flashbacks sind keine Seltenheit, beispielsweise unwillkürliches Erstarren, Zittern oder das Gefühl der Lähmung in ähnlichen Situationen oder automatische Bewegungen: „Wann immer jemand vor meinem Gesicht plötzlich seine Hand hebt, schnellen meine Arme wie zum Schutz hoch obwohl ich weiß, hier werde ich von niemandem geschlagen.“ (Eine Patientin).
Ich persönlich betrachte Flashbacks wie Lesezeichen in einem Buch. Sie sind an Stellen in unserem Trauma-Erinnerungsfilm angebracht, an denen wir auch nach Jahren, wenn wir das Erlebte längst verdrängt haben, einen Einstieg finden, das Geschehene zu verarbeiten und zu integrieren (vgl. Heine, 2019).
Epidemiologie:
Die Häufigkeit einer PTBS oder engl. PTSD (= post-traumatic stress disorder) ist abhängig von der Art des Traumas.
Ca. 50% Prävalenz nach Vergewaltigung
Ca. 25% Prävalenz nach anderen Gewaltverbrechen
Ca. 20% bei Kriegs- und 15% bei Verkehrsunfallopfern
Ca. 15% bei schweren Organerkrankungen, (Herzinfarkt, Malignome)
Die Lebenszeitprävalenz für PTSD in der Allgemeinbevölkerung liegt zwischen 2% und 7%. Die Prävalenz subsyndromaler Störungsbilder (=abgeschwächte Verläufe) ist wesentlich höher. Hier besteht eine hohe Chronifizierungsneigung.
Posttraumatische Belastungsstörungen gehen meist mit depressiver Symptomatik einher, was eine Differenzierung und klare Abgrenzung der Diagnose gegenüber einer Depression mitunter schwierig macht. Auch Suizidgedanken können auftreten.
Klarheit in der Unterscheidung zur Depression kann die Frage bringen, ob ein Patient sich ansonsten über erfreuliche Dinge / Situationen / Menschen (z.B. Partner, Kinder, Haustiere) noch freuen kann und noch Interesse an seinen Hobbys hat. Ob er seine Ressourcen nutzt, um sich abzulenken und ihm das auch gelingt. Bei depressiven Störungen ist dies typischerweise nicht der Fall.
Statistisch gesehen dauert eine traumatische Symptomatik nur wenige Wochen oder Monate an. Sie soll nur diagnostiziert werden, wenn sie innerhalb von sechs Monaten nach einem traumatisierenden Ereignis von außergewöhnlicher Schwere aufgetreten ist. Treten die typischen Merkmale später auf, kann eine „wahrscheinliche“ Diagnose gestellt werden.
Bestehen noch Jahre nach extremer Belastung chronifizierte Folgen, so sollen diese als andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung (F62.0) klassifiziert werden.
Psychosoziale Notfallversorgung bei einem Trauma
Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) von Überlebenden, Angehörigen, Hinterbliebenen, Vermissenden sowie Einsatzkräften und weiteren von schweren Not- und Unglücksfällen sowie Katastrophen Betroffenen gehört national wie international inzwischen zum Versorgungsstandard. Sie definiert zeitliche und inhaltliche Abläufe für notfallpsychologische Hilfe.
Im Rahmen der psychologischen Notfallversorgung von traumatisierten Menschen gibt es definierte zeitliche und inhaltliche Interventionen sowie Interventionsketten, die skizzieren, wie Hilfestellungen für akut traumatisierte Menschen aussehen können.
Primäre Prävention
Hier sind alle Maßnahmen angesiedelt, die geeignet sein können, die Entstehung von Traumatisierung zu vermeiden. Inhaltlich geht es darum, Kontakt zum Betroffenen herzustellen, seinen aktuellen Zustand festzustellen und auf dringende Bedürfnisse einzugehen.
Einige der Grundregeln hierfür lauten:
Information hilft gegen Kontrollverlust
Handeln Hilft gegen Ohnmacht und Hilflosigkeit
Ruhiges und sicheres Auftreten hilft gegen Angst
Struktur hilft gegen Chaos
Rationales Denken hilft gegen Gefühlsüberschwemmung
Verlangsamung hilft gegen Übererregung
Schlafentzug als primäre Prävention
Die Quelle und Inspiration zu dieser Intervention fand ich vor vielen Jahren in einer Zeitschrift über Immunbiologie, die ich leider verlegt habe. Ich kann also nur noch aus dem Gedächtnis berichten: Wenn man Sie und mich mit einem Impfstoff impft und Sie in der darauffolgenden Nacht schlafen, ich jedoch wach bleibe, so sind in Ihrem Blut am Folgetag doppelt so viele Antikörper nachweisbar, wie in meinem Blut. Sie haben also einen besseren Nutzen aus der Impfung gezogen, als ich. Sie haben den Impfstoff besser integriert.
Ein traumatisches Erlebnis und die dabei entstehenden Gefühle und Emotionen wirken biochemisch gesehen im Körper ebenfalls wie eine Impfung. Werden zwei Menschen mit einem Trauma „geimpft“, hat derjenige, der in der darauffolgenden Nacht wach bleibt die Chance, weniger oder schwächere Symptome davon zu tragen als derjenige, der schläft. Das traumatische Erleben wirkt in ihm weniger nachhaltig, weil der Schlaf ausbleibt, in dem die Tagesereignisse dauerhaft ins Gehirn integriert werden.
Ich hatte in meiner Praxis bereits häufig Gelegenheit, Schlafentzug als primäre Prävention am realen Fall auszutesten und traumatherapeutisch zu begleiten. Die Symptomentwicklung und die Wahrscheinlichkeit, eine Traumafolgestörung zu entwickeln, ließ sich minimieren, wenn ein Betroffener die Möglichkeit hatte, die erste Nacht nach einem traumatischen Ereignis wach zu bleiben. Diese Betroffenen brauchten im Schnitt rund ein Drittel weniger Sitzungen, um das Geschehene zu integrieren (vgl. Heine, 2019).
Was tun in der durchwachten Nacht?
Natürlich habe ich meine Patienten befragt, welchen nächtlichen Beschäftigungen sie im Nachhinein als positiv und wirkungsvoll bewerten. Die meisten umgaben sich gerne mit Menschen, die ihnen guttun. Einigen war wichtig, über das Geschehene zu reden, andere wiederum lenkten sich lieber mit Filmen und Spielen ab oder gingen ins Kino, zum Essen oder unternahmen anderes, um möglichst noch viele Eindrücke zu sammeln, ehe der neue Tag anbrach. Das ist im Grunde genau, worum es geht: Sammeln Sie nach dem traumatischen Erlebnis zeitnah möglichst noch viele andere, untraumatische Eindrücke! Geben Sie sich viele andere „Impfungen“, die Ihre „Trauma-Impfung“ in den Hintergrund rücken lassen.
Eine Patientin – Buchhalterin – erklärte sich die positive Wirkung des Schlafentzugs anhand eines Buchhaltungsprogramms: „Ich stelle mir meine Tageserlebnisse wie einzelne Buchungen vor. Diese Buchungen werden zunächst als Buchungssatz ins „Journal“ – mein inneres Buchungsprogramm – gestellt. Die Erlebnisse kann ich zwar aus meinem Gehirn nicht mehr löschen wie ich einen Buchungssatz am PC aus dem Journal löschen kann, ich kann jedoch ihre Nachhall-Wirkung abschwächen, indem ich meinem Journal viele weitere Buchungssätze hinzufüge. Lege ich mich dann schlafen, werden die Erlebnisse aus dem Journal fest in mein Gehirn gebucht. Es sind jedoch mittlerweile so viele, dass die Trauma-Buchung darin viel kleiner und weniger mächtig ist als wäre sie die einzige oder die letzte gewesen, mit der ich einschlafe. So fühlt es sich jedenfalls im Nachhinein an. Ich fühle mich, als wäre das Erlebte schon Tage her, anstatt nur eine Nacht.“ (vgl. Heine, 2019)
Die Praxiserfahrung und positive Rückmeldungen meiner Patienten, die diese Intervention nutzten, beziehen sich u.a. auf Erlebnisse aus den folgenden Bereichen:
Suizid eines Ehepartners, des Kindes, eines Familienangehörigen oder Freundes
Zugführer nach Personenunfällen
Ersthelfer nach Unfällen und bei Brandverletzten
Polizei und Feuerwehr nach problematischen Einsätzen oder Auswerten von stark belastendem Videomaterial
Sexuelle Belästigung / Sexueller Missbrauch / Vergewaltigung
Überfälle mit Waffengewalt
Sekundäre Prävention
Sie meint die psychologische „Erste Hilfe“. Hier finden Einzel- und Gruppengespräche statt. Es geht um Organisations- und Familienunterstützung. Ziel ist eine Stabilisierung des Betroffenen. Sie setzt ab der ersten Woche nach dem Trauma an und beinhaltet vor allem frühe Interventionen, die nach dem Abklingen der Schockphase zur Stabilisierung beitragen sollen. Hierzu gehören alle Maßnahmen die den Betroffenen darin unterstützen, das Geschehene kognitiv einzuordnen und ihm hilfreiche Bewältigungsstrategien anzubieten, sogenannte Skills. Hierzu zählen unter anderem:
Ablenkung
Vermeidung auslösender Reize
Körperliche Aktivität
Sozialer Austausch
Feste Tagesstruktur bzw. Beibehaltung bereits vor dem Trauma bestehender Routinen
Tertiäre Prävention
In dieser Phase geht es um psychotherapeutische Begleitung nach der Akutphase. Sie setzt zeitlich etwa ab der vierten Woche an. Hier werden geeignete therapeutische Interventionen empfohlen, um den Betroffenen zunächst zu stabilisieren, das Geschehene anschließend zu bearbeiten und dann zu integrieren. Als Grundlage hierfür dient…
…Janets 3-Phasen-Modell der Traumatherapie
Nach Pierre Janet, dem Begründer der modernen, dynamischen Psychiatrie werden Erfahrungen, die unter extremen emotionalen Bedingungen gemacht werden, anders im Gedächtnis abgelegt als normale Erfahrungen. Da traumatische Erfahrungen nicht in den vorhandenen Erfahrungsschatz des Individuums integriert werden können, kommt es zu einer Desintegration und Fragmentierung des Bewusstseins. Die Erfahrungen werden in dissoziierter, fragmentierter Form abgespeichert. Die dissoziierten fragmentierten Anteile entziehen sich dann oft dem persönlichen Bewusstsein. Für traumatisierte Menschen ist das traumatische Ereignis nicht „bewusst“ geworden. Bewusstwerden bedeutet, das Ereignis in Worte zu fassen, es als Begebenheit zu erzählen, die Erfahrung innerhalb der eigenen Person zu versöhnen und dadurch die Kontinuität der eigenen Geschichte wiederherzustellen (vgl. Janet, 1889).
Janet stellte erstmals einen systematischen und phasenorientierten Plan für die Aufarbeitung traumatischer Erfahrungen und posttraumatischem Stress auf und gilt mit seinen therapeutischen Ansätzen als Wegbegleiter der modernen Psychotherapie:
Phase 1: Stabilisierungsphase, in der es um Ich-Stärkung, Symptomreduktion und Ressourcenmobilisierung geht. Hierzu zählt die Arbeit mit stabilisierenden Imaginationen, Affekt-und Dissoziationskontrolle, z.B. mit Hilfe von Achtsamkeits-und Imaginationsarbeit sowie zahlreiche andere Interventionen.
Phase 2: Traumakonfrontation, z.B. durch Exposition (Eintauchen und Abreagieren gestauter Emotionen) oder mittels Beobachtertechnik (distanzierte, sichere Position).
Phase 3: Integration, Trauern und Neubeginn.
Traumafolgestörungen
Traumafolgestörungen sind primär zunächst normale Reaktionen auf ein unnormales Ereignis. Ausprägung und individuelles Symptombild hängen wesentlich von der intrapersonalen (inneren) Kommunikation des Betroffenen ab. Je nach Erfahrung, Wissen, eigenen Werten sowie Emotionen und Gefühlen setzt sich das innere System eines Menschen mit den Informationen aus einem Ereignis auseinander und bewertet sie. Dies wiederum bildet die Basis für jede interpersonale (zwischenmenschliche) Kommunikation mit dem sozialen Umfeld und den daraus resultierenden Feedbacks.
Ob ein Mensch mit posttraumatischer Belastungsstörung später auch an einer Traumafolgestörung erkranken wird, ist schwer vorhersagbar. Zu viele physiologische, psychologische wie auch soziale Prozesse sind hierfür mit ausschlaggebend.
Primäre psychische Störungen
Zu den möglichen psychischen Störungen nach einer Traumatisierung zählen:
- Akute Belastungsreaktion
- Anpassungsstörungen
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung (z.B. komplexe Störungsbilder nach Mehrfachtraumatisierung)
Sekundäre psychische Störungen
Nach einer unverarbeiteten traumatischen Erfahrung gilt das Risiko für die Entwicklung psychischer Erkrankungen allgemein als erhöht. Folgestörungen können u.a. sein:
- Psychosomatische Symptome / Somatoforme Störungen
- Affektive Störungen (Depression / Dysthymie)
- Angststörungen / Panikstörungen
- Suchterkrankungen
- Phobien
- Essstörungen
- Borderline Persönlichkeitsstörung
- Phasen von Suizidalität
Klassifikation von Traumata/Trauma-Typen
Ein Typ-1 Trauma oder auch Schocktrauma liegt vor, wenn es sich um ein kurzes, akutes und begrenztes traumatisches Ereignis handelt, bei dem spätestens nach dem Geschehen selbst sozialer Beistand, Schutz und Hilfe durch andere gegeben ist. Die Opfer können in der Regel mit nahestehenden Personen oder Helfern über das Ereignis sprechen, beispielsweise nach Unfällen, Naturkatastrophen oder kriminellen Überfällen.
Von einem Typ-2 Trauma (Entwicklungstrauma; Komplextrauma) spricht man, wenn Menschen wiederholt länger andauernde und schwere Bedrohungen und/oder Gewalt durch andere Menschen erleiden müssen, z.B. bei längeren Geiselnahmen, Kriegshandlungen und Verfolgungen. Die häufigsten Traumatisierungen vom Typ-2 ereignen sich in Deutschland jedoch im Rahmen sogenannter familiärer Gewalt und hier wiederum in Form von emotionalen, physischen und sexuellen Missbrauchshandlungen während der Kindheit.
Darüber hinaus wirkt sich interpersonelle Gewalt, also ein von Menschen verursachtes Trauma wie ein Überfall oder eine Vergewaltigung intensiver und nachhaltiger aus als akzidentelle, also unglücksähnliche Ursachen wie beispielsweise eine Naturkatastrophe oder ein Autounfall.
Wie genau sich ein Trauma letztendlich auf einen Menschen auswirkt, hängt von zahlreichen weiteren Faktoren ab:
Risiko- und Schutzfaktoren eines Traumatas
Als Risikofaktor gilt allgemein ein junges Alter oder wenn ein Betroffener bereits früher (z.B. in der Kindheit) Traumatisierungen erlebt hat. Auch Geschlecht und Grat der Bildung können Einfluss auf die psychische Reaktion nach einer Traumatisierung haben.
Wesentlich jedoch sind die Ereignisfaktoren während und die beeinflussenden Faktoren nach der eigentlichen Traumatisierung.
Ereignisfaktoren
Die Wahrscheinlichkeit, eine Traumafolgestörung zu entwickeln, nimmt mit der Schwere und Länge der erlebten Situation zu (z.B. Schadensausmaß, Anzahl der Toten / wiederholte sexuelle Angriffe innerhalb der Familie).
Persönliche Faktoren
Hier spielt neben der objektiven, äußeren Wahrnehmung die subjektive, innere Wahrnehmung die größte Rolle. Ob sich ein Ereignis wirklich traumatisch auf den Betroffenen auswirkt, hängt also im Wesentlichen vom inneren Erleben des Betroffenen ab. Was das Alter der Betroffenen anbelangt, spricht man von einem „U-förmigen Verlauf“. Das bedeutet, sehr junge und alte Menschen erkranken leichter als Menschen in mittlerem Alter.
Zur Unterstützung und Therapie ist es wichtig für die Betroffenen, dass Außenstehende oder Therapeuten das vom Betroffenen Erlebte nicht mit ihrer eigenen Einschätzung, sondern zunächst aus Sicht der inneren Einschätzung des Betroffenen betrachten. Jedes „nicht gehört werden“ oder „nicht ernst genommen werden“ vom sozialen Umfeld kann später Symptome verstärken.
Initiale Reaktion
Auch hier sind wir vorwiegend in der inneren Wahrnehmung und Wertung des Geschehenen und zwar, während es passiert ist. Konnte ein Betroffener sich während des Ereignisses ein wenn auch nur geringes Maß an Selbstbestimmung bewahren, so waren in der Folge die Symptome weniger ausgeprägt als wenn der Betroffene sich völlig hilflos und ohnmächtig erlebt. Weiterhin gilt, dass das Trauma-Ausmaß zunimmt, sobald der Betroffene mit Dissoziation reagiert.
Gesundheitsfördernde Faktoren (Ressourcen)
Die zentrale Rolle bei der Gesundheitsförderung kommt dem sozialen Umfeld zu. Es geht für die Betroffenen primär darum, mit ihrem Erlebten ernst genommen zu werden und angenommen sein mit ihrem inneren Empfinden dessen, was passiert ist.
„Die Unterstützung durch das soziale Umfeld und die Anerkennung als Opfer können einen positiven Einfluss auf den Verlauf einer posttraumatischen Belastungsstörung ausüben. Ebenso ist es hilfreich, wenn die Traumatisierten eine Möglichkeit der zwischenmenschlichen Einbettung haben und über das Erlebte offen kommunizieren können (Disclosure).“ (Andreas Maercker, 2017))
Trauma: Folgen für das Gedächtnis
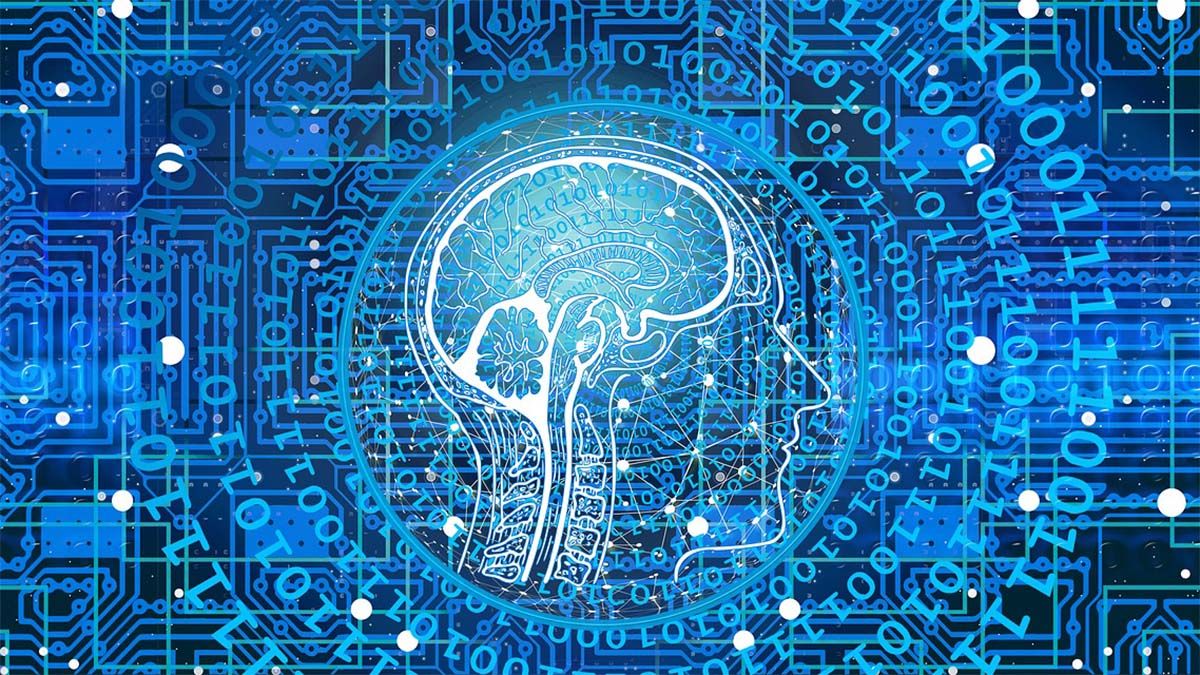
Durch die massive Ausschüttung von Stresshormonen gerät die räumliche und zeitliche Erfassung von Sinneseindrücken aus dem Gleichgewicht. Zu viele Neurohormone verhindern jetzt, dass der Hippokampus, unser explizites Gedächtnis, das Geschehene auf altbewährte Art in Kategorien wahrnehmen und erfassen kann. Stattdessen landen fragmentierte Gedächtnis-protokolle der visuellen, akustischen, olfaktorischen und kinästhetischen Eindrücke des Geschehens in der Amygdala, unserem impliziten Gedächtnis. Sie sind später Inhalt möglicher Flashbacks.
Was ist Retraumatisierung?
Retraumatisierung meint das wiederholte Erleben eines psychischen, seelischen oder mentalen Traumas. Dabei wird das ursprüngliche Trauma-Erleben reaktualisiert. Unterschieden wird, ob dies im Alltag passiert oder innerhalb des professionellen, therapeutischen Umgangs mit traumatisierten Menschen. Es ist möglich, dass ein Mensch im Alltag durch absichtliches oder zufälliges Erleben eines Traumas der gleichen Art wie das, was er bereits erlebt hat, erneut in eine traumatische Reaktion gerät.
Im professionellen, beruflichen Umfeld meint dies beispielsweise Vernehmungen bei der Polizei oder vor Gericht sowie beratende oder therapeutische Interventionen. Therapeutische Trauma-Expositionen gelten per se nicht als retraumatisierend, da sie den Patienten zwar belasten, ihm jedoch im Anschluss nachhaltige Erleichterung verschaffen.
In weniger schwerwiegenden Fällen führt eine Retraumatisierung zu einer kurzen Verschlechterung für den Betroffenen. Fehlen ihm jedoch innere, emotionale Stabilisierungsmöglichkeiten, kann dies zu einer länger anhaltenden Verschlechterung führen.
Was ist Dissoziation?
„Das allgemeine Kennzeichen einer dissoziativen Störung besteht in teilweisem oder völligem Verlust der normalen Integration der Erinnerung an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der Wahrnehmung unmittelbarer Empfindungen oder der Kontrolle von Körperbewegungen.“ (Dilling, Freyberger, 2014). Im Gehirn, werden plötzlich Wahrnehmungs- und Gedächtnisinhalte getrennt, die normalerweise assoziiert sind.
Eine dissoziative Störung kann in naher zeitlicher Verbindung zu einem traumatisierenden Ereignis auf oder im Zusammenhang mit unlösbaren, unerträglichen Konflikten und Beziehungen auftreten. Eine akute Dissoziation während eines traumatischen Erlebnisses ist einer der stärksten Präindikatoren für die Möglichkeit einer später auftretenden Posttraumatischen Belastungsstörung.
Die Fähigkeit für den Betroffenen, diesen Zustand zu kontrollieren oder gar zu verhindern ist in einem Ausmaß gestört, das von Tag zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde wechseln kann.
Was eine Behandlung erschweren kann ist, dass Patienten mit dissoziativen Störungen häufig ihre für andere ganz offensichtlichen Probleme verleugnen.
In der Psychologie geht man davon aus, dass das Auftreten dissoziativer Zustände einige Wochen oder Monate nach einem traumatischen Erlebnis von alleine remittiert. Dissoziative Zustände, die bereits länger als ein bis zwei Jahre bestehen, bevor sie in psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung gehen, gelten häufig als therapieresistent.
Die Trennung von sich selbst bei einem Trauma
Betroffene werden von Außenstehenden häufig als abwesend oder zerstreut erlebt. Bei stärkeren Abspaltungen wirken sie gefühlsarm (Affektarmut). Ihr Zugang zu eigenen Gefühlen geht häufig verloren (Alexithymie).
Geschieht Traumatisches, ist die Trennung von sich selbst eine der wichtigsten Überlebensfunktion der menschlichen Psyche. Die Fähigkeit des Geistes, sich bei Überforderung oder Unverständnis auf diese Weise von sich selbst zu trennen sichert ein Überleben in lebensbedrohlichen Situationen.
Betroffene treten gleichsam in ein anderes Raum- Zeit-Gefühl ein (Derealisation). Sie nehmen das Geschehen „von außen“ wahr, ohne emotional beteiligt zu sein oder sich mit der überwältigten Person zu identifizieren (Depersonalisation). Eingeleitet und unterstützt wird diese Reaktion durch die Aktivierung von Endorphinen (körpereigene Opiate). Das Schmerzempfinden geht verloren (Analgesie), Angst- oder Panikgefühle werden ausgeblendet (Gefühlstaubheit).
Dissoziation als Trancezustand (Trauma-Trance)
Dissoziation und Trance sind verwandt. Jeden Augenblick, in dem wir uns unser selbst nicht voll bewusst sind wie beispielsweise beim Autofahren oder vertieft in eine Tätigkeit, die uns alles um uns herum vergessen lässt, haben wir einen Teil von uns dissoziiert. Wir befinden uns dann in einer so genannten „Alltagstrance“. Das geschieht viele Male am Tag und ist ein normales Phänomen. Der Unterschied zur krankhaften Dissoziation besteht darin, dass wir unsere Aufmerksamkeit normalerweise bewusst ausrichten können und die dissoziierten oder gerade nicht bewussten Anteile wieder in den Fokus unseres Bewusstseins rücken können. Das ist von Traumatisierung Betroffenen nicht möglich und sie verharren immer wieder in ihrer Trauma-Trance.
Erscheinungsformen und Ausprägungen dissoziativer Störungen:
Alltagsdissoziation
Amnesie: keinen Zugang mehr zu Erinnerungen zu haben
Derealisationserscheinungen: sich fremd in der Welt fühlen oder wie in Watte gepackt oder zu bestimmten Sinnesreizen keinen Zugang mehr zu haben.
Depersonalisationserscheinungen: „neben sich stehen“, sich nicht mehr mit sich selbst identifizieren können, dauerhafte Analgesie (Schutz vor Schmerzen).
Fugue: (franz.: Flucht) vollkommener „Filmriss“, nicht mehr wissen, wie man an einen Ort gekommen ist.
Primäre Strukturelle Dissoziation - Einfache Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Schocktrauma: Ein Aparently Normal Part (ANP, Anscheinend normaler Persönlichkeitsanteil) und ein Emotional Part (EP, Emotionaler Persönlichkeitsanteil).
Sekundäre strukturelle Dissoziation – Komplexe PTBS, Entwicklungstrauma, Komplextrauma, Borderline-Störungen: Ein ANP und mehrere EPs
Dissoziative Identitätsstörungen (Tertiäre strukturelle Dissoziation): mehrere ANPs und mehrere EPs
Eine der am häufigsten beobachteten, dissoziativen Erscheinungen ist die Dissoziation vom eigenen Körper. Der Betroffene hat keinen Zugang zu den Empfindungen seines Körpers (gestörte Interozeption). Informationen werden jetzt nicht mehr über die Außenwelt, sondern aus eigenen Körperabschnitten oder über eigene Körperabschnitte erfasst. Der Betroffene ist wie abgeschnitten von grundlegenden Informationen über seinen eigenen Zustand. In der Folge können psychosomatische Störungsbilder entstehen.
Körperliche Auswirkungen eines Traumas

Hormonelle Stress-Reaktion
Nach einem traumatischen Erlebnis kann es sein, dass der innere Alarmzustand weiter andauert, auch wenn das Ereignis selbst vorbei ist. Anstatt zu einer Entspannung kommt es dazu, dass Noradrenalin weiterhin ins Blut abgegeben wird. Anstatt also kurzfristig einen Angriffs- oder Fluchtreflex auszulösen, verursacht es nun einen andauernden, inneren Alarmzustand. In der Folge gerät das natürliche Gleichgewicht der für unsere Stressverarbeitung relevanten Neurotransmitter und Hormone aus den Fugen. Begleitsymptome können sein: innere Unruhe, Schlaflosigkeit, erhöhte Schreckhaftigkeit, Konzentrationsschwäche, schnelle Erschöpfung, Grundgefühl der Überforderung, zunehmende Probleme bei der Alltagsbewältigung.
Hält die hormonelle Stress-Reaktion zu lange an, können Organsysteme und Stoffwechselprozesse, die auf einem hormonellen Gleichgewicht aufbauen, ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden. Häufig zeigen sich Folgen erst Monate oder sogar Jahre nach einem traumatischen Erlebnis. Die nachhaltigen Störungen im Hormonhaushalt oder im Herz- / Kreislaufsystem manifestieren sich schließlich als Stresserkrankungen, die u.a. mit Erschöpfungssymptomen bis hin zu Burnout korrespondieren.
Wann ist Hilfe bei einem Trauma nötig?
Egal, ob bei Schwierigkeiten im Alltag oder im Umgang mit überwältigenden Gefühlen: Ebenso wie man bei körperlichen Verletzungen einen Arzt aufsucht sollte es normal sein, sich bei seelischen Verletzungen helfen zu lassen. Neben einer psychotraumatologischen Erstberatung kann so festgestellt werden, ob der Betroffene einer Risikogruppe für die Entwicklung von Langzeitfolgen angehört und was im Einzelfall an Hilfe oder Vermeidung weiterer Symptome Sinn macht und möglich ist.
Deutschlandweit stehen für psychische Notfälle Beratungsstellen und Trauma-Ambulanzen zur Verfügung. Es gibt vielerorts Notfallseelsorger, Selbsthilfegruppen und eine deutschlandweit organisierte Telefonseelsorge. Von seelischer oder körperlicher Gewalt Betroffene können sich an den Weißen Ring e.V. wenden, einen Verein, der sich deutschlandweit um Opferschutz und Prävention bemüht. Im Zweifel kann sich jeder Betroffene auch mit seelischen Verletzungen zunächst an den Arzt seines Vertrauens wenden und dort um Hilfe bitten.
Langzeitfolgen eines Traumas
Auch noch Jahre nach einem traumatischen Erlebnis besteht die Möglichkeit, es therapeutisch aufzuarbeiten. Unsere Seele als Teil unseres Unterbewusstseins kennt keine Zeit, wie wir sie im bewussten Sinne begreifen. Alle Ereignisse, alles Erlebte bleibt im seelisch ewigen Jetzt erhalten.
Das ist, wie wenn Sie ein Haus bauen. Die Steine, mit denen sie es bauen, verschwinden nicht in dem Moment, wo sie sie aus der Hand legen und das Haus verschwindet nicht, wenn sie es aus den Augen verlieren. Vergangenes bleibt im inneren Erleben erhalten und ist auch nach Jahren noch ansteuerbar und erinnerbar.
Eines der wichtigsten Instrumente in der Therapie ist die zeitliche Intervention. Ein Mensch, der Schlimmes erlebt hat weiß bewusst vom Verstand her, dass das Trauma vorbei ist. Die innere zu großen Teilen unbewusste Realität sorgt dafür, dass der Betroffene mitunter noch lange nach einem erlebten Trauma zeitweise so reagiert, als sei das Ereignis nicht vorbei. Im therapeutischen Prozess ist es möglich, bewusst gedanklich, körperlich und emotional fühlbar werden zu lassen, dass das Trauma vorbei ist (vgl. Heine, 2019).
Therapiemethoden
Es gibt mittlerweile zahlreiche therapeutische Interventionsmöglichkeiten, mit Traumatisierung zu arbeiten. Manche legen dabei ihren Schwerpunkt mehr auf die Arbeit mit dem Bewusstsein, andere beziehen zusätzlich die Arbeit mit dem Unterbewusstsein mit ein. Als geeignete Therapien zur Aufarbeitung traumatischer Erfahrungen werden unter anderem empfohlen:
- Einzelpsychotherapeutische Verfahren
- Entspannungsverfahren
- Hypnotherapie
- EMDR
- Psychodynamische, tiefenpsychologische Verfahren
- Kombinationen von verhaltenstherapeutischer Expositionstherapie und Testimony Therapy (= wiederholte Auseinandersetzung mit dem traumatischen Inhalt mit dem Ziel der Gewöhnung)
Kontraindikation für Trauma-Arbeit
Nicht alles ist für alle richtig. Es gibt Umstände, in denen es Sinn macht, ausschließlich stabilisierend zu arbeiten oder in erster Linie psychiatrisch zu intervenieren. Solche Umstände können sein:
- Fehlende innere Stabilität
- Akute Suizidalität
- Suchtmittelabhängigkeit
- Chronische Übermüdung
- Akute Angstzustände / akute dissoziative Zustände
- Unfähigkeit zur Affektkontrolle
- Psychotische Episoden
- Borderline-Persönlichkeit
- Manisch-depressive Störung
- Trauma als Teil der eigenen Identität (sekundärer Krankheitsgewinn)
- Unsichere Lebensumstände
- Traumatische Situation dauert an / Täterkontakt dauert an
- Zusätzlich akute, massiv belastende Lebensumstände (Wohnungslosigkeit, fehlendes, soziales Netz, akute Trennungsphase vom Partner, etc.)
Autor: Anni Heine
Thema: Was ist ein Trauma
Webseite: https://www.psychotherapie-rv.de
Quellenverzeichnis:
- Bernardy, Friedman. (2015). A Practical Guide To PTSD Treatment. (American Psychological Association (APA), Washington).
- Fischer und Riedesser. (2003). Lehrbuch der Psychotraumatologie (Ernst Reinhardt Verlag München, Basel).
- Dilling, Freyberger. (2014). Taschenführer zur ICD10-Klassifikation psychischer Störungen. (Verlag Hans Huber, Bern, S. 171-175).
- Freud, S. (Kindle-Edition, 2017). Hemmung, Symptom und Angst. (OK Publishing, Dachau, Pos. 1153 ff).
- Heine, Anni. (2019). Endlich wieder Boden unter meinen Füßen – Trauma-Integrationsarbeit mit der Fallschirm-Methode. (Verlag für Systemische Konzepte, Ravensburg).
- Jant, P. (1889). L’Automatisme Psychologique.Maercker, A. (2017).
- Maercker, A. (2017). Trauma und Traumafolgestörungen. (C. H. Beck Verlag, München).









